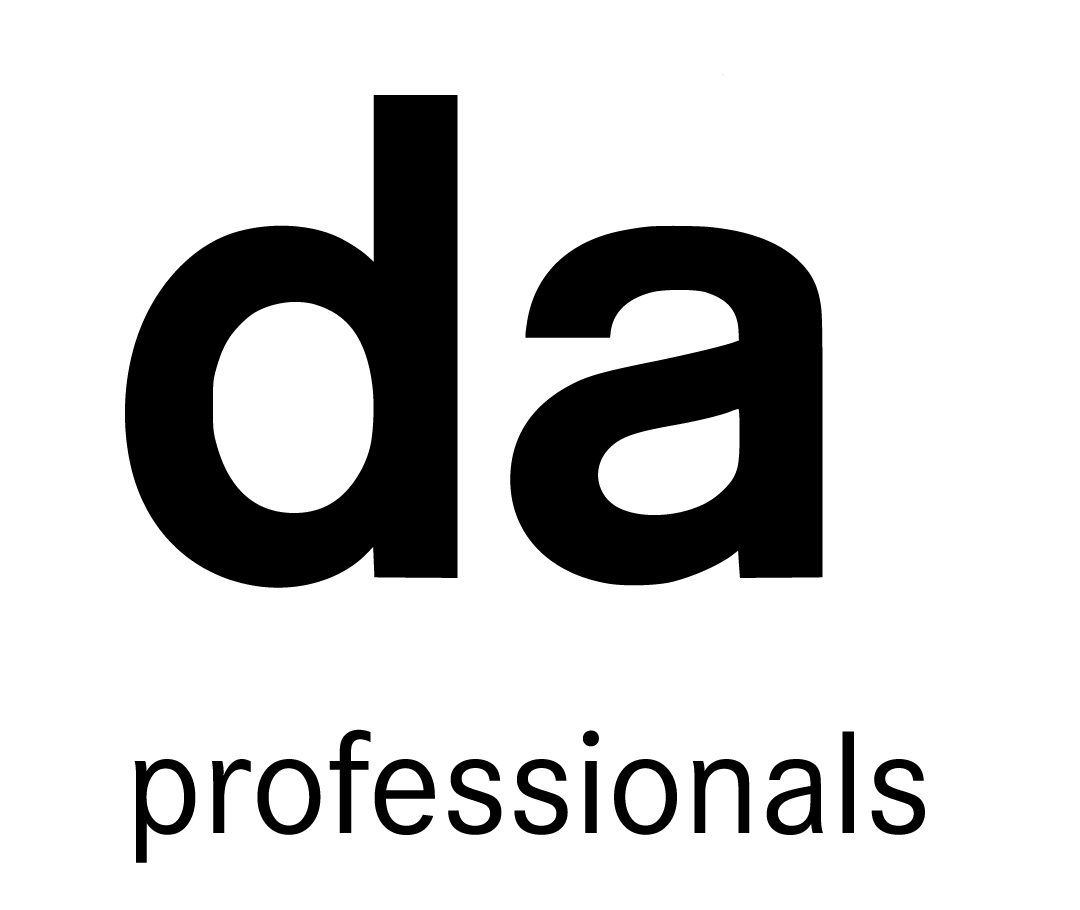Vielfalt beginnt im Kopf, nicht mit einer Kampagne

Ein spannender Blogartikel aus unserem Archiv, der zum Nachdenken anregt:
In unserem Artikel aus dem Jahr 2020 hat eine ehemalige Mitarbeiterin die oberflächlichen Diversity-Kampagnen vieler Unternehmen und die fehlende Vielfalt in der Realität thematisiert. Vier Jahre später stellt sich die Frage: Hat sich etwas verändert? Sind wir als Gesellschaft weitergekommen? Nehmen Sie an der Diskussion auf LinkedIn teil: Hier geht es zur Diskussion.
Aus unserem Archiv.
Diversity liegt im Trend. Immer wieder lancieren Grossunternehmen wohlklingende Kampagnen, die ihre Vielfalt proklamieren. Was ich von dieser angeblichen Vielfalt in meiner Beratertätigkeit in den letzten 10 Jahren gemerkt habe? Gar nichts. Und das zeigt: In den Köpfen der Entscheidungstragenden muss sich etwas verändern – sonst nützt auch die beste Kampagne nichts.
Die Swiss Re untersagt ihren angestellten Personen ab sofort den Gebrauch der genderspezifischen, familienbetonten Begriffe wie «Heirat», «Mann» und «Frau». Diese überraschende Kunde war im März 2019 zu lesen. Damit will der Versicherer Minderheiten besser in den Arbeitsmarkt inkludieren.
Ist das der hoffnungsvolle Startschuss für eine gesellschaftliche Umwälzung und das Ende des diskriminierenden Ausschlusses exotischer Gruppen auf dem Arbeitsmarkt? Oder viel eher ein geniales Kandidierenden-Marketing, mit dem die Swiss Re ihre Arbeitgebermarke attraktiver macht und demnach doch nicht ganz so selbstlos, wie man meinen könnte?
Wie auch immer: Eine solche Kampagne stösst ein längst fälliges Thema an und erzielt damit hoffentlich eine öffentliche Breitenwirkung. Im besten Fall führt sie zu mutigen Nachahmer:innen und dazu, dass engstirnige Abwehrreaktionen zurückgehen und verkorkte Denkmuster sich auflösen.
Miese Bilanz nach 10 Jahren Rekrutierung
Als ich die Ankündigung der Swiss Re las, wurde mir mit Schrecken bewusst, wie eng die Bahnen sind, innerhalb derer ich mich in meiner Beratertätigkeit bewege – nicht nur punkto Gendermainstreaming, sondern genauso in Bezug auf weitere Minderheiten der Gesellschaft. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass sich die Früchte meiner Rekrutierungsmandate über das letzte Jahrzehnt erschreckend normiert präsentieren. Ja, wir bewegten uns meist im klassischen, grundsätzlich konservativ gestimmten Wirtschaftsumfeld, das für Norm-Abweichungen in aller Regel wenig übrighat.
Natürlich machen wir uns als Berater:innen immer wieder für Gender-Gleichstellung stark, indem wir etwa männliche Kandidaten anstelle weiblicher Vorgaben portieren oder umgekehrt. Mit unterschiedlichem Erfolg – scheinen doch die Präferenzen auf Klientelseite teilweise in Stein gemeisselt.
Doch dies ist ein relativ bescheidener Leistungsausweis unsererseits, denn: Es ist mir in all den Jahren bei einer Vielzahl unterschiedlicher Mandate nicht gelungen, übergewichtige, behinderte, ausgesteuerte, dunkelhäutige, transsexuelle oder gar über 55-jährige Kandidat:innen im Markt zu platzieren.
Nicht mal Kandidat:innen mit unüblichen Präferenzen in Sachen Lebensgewohnheiten, Kleidung oder Frisur. Wie denn auch, wenn auf Kundenseite meist schon ein Aufschrei bei Kandidat:innen mit Piercings oder sichtbaren Tattoos erfolgt? Es steht mir fern, hiermit unsere Kund:innen anzugreifen oder sie plakativ über einen Leisten zu schlagen, denn sie geben nun mal ein durchschnittliches Bild des heutigen Arbeitgebermarktes wieder.
Sollten sich die Tendenzen des Fachkräftemangels über zusätzliche Berufsgattungen einst zuspitzen, so bedeutet dies im besten Fall eine Chance für bislang im Selektionsprozess ausgesonderte Kandidat:innen. Ich würde mich freuen.
Wie viel Schuld habe ich?
Ob ich als Beraterin eine Mitschuld an dieser tristen Statistik trage lässt sich wohl mit Jein beantworten. Was hätte ich tun können, um die strikten Barrieren bei der Selektion zu umgehen? Hätte ich vermehrt meine Verantwortung als Lanzenbrecherin für Kandidatinnen und Kandidaten am rechten oder linken Ende des Feldes wahrnehmen sollen?
Wenn bei manchen Firmen bereits Voten zugunsten Teilzeitpensen oder Homeoffice im Namen der Kandidat:innen auf Granit stossen, wie gross ist der Überzeugungskampf bei Bewerber:innen mit obengenannten Besonderheiten? Noch allzu wach sind die unangenehmen Erinnerungen, wie ich mit einer stark pigmentierten Assistentin, einer besonders beleibten Sachbearbeiterin oder einem 58-jährigen Kandidaten beim HR hochgradig abgeblitzt bin. Ich war schockiert und machtlos zugleich.
Es handelt sich bei diesen Reaktionen leider keineswegs um Ausnahmen, sondern lediglich um die markantesten Reaktionen auf Kandidat:innen, die nicht der gängigen Norm entsprechen. Ja, vermutlich habe ich «auffällige» Kandidat:innen in Annahme der fehlenden Offenheit auf Klientelseite schon gar nicht vorgestellt – teilweise auch, um ihnen eine weitere Enttäuschung auf dem unerbittlichen Bewerber:innen-Laufsteg zu ersparen. Ein einziges Mal in zehn Jahren konnte ich einen männlichen Assistenten platzieren – wobei fairerweise zu erwähnen ist, dass das diesbezügliche Bewerberfeld in aller Regel sehr überschaubar ist.
Was sind die Ursachen für die fehlende Offenheit seitens der Unternehmen bei der Berücksichtigung von exotischen Persönlichkeiten ausserhalb der gängigen Konventionen? Oftmals wird die Unternehmenskultur vorgeschoben, die sich mit andersfarbigen, tätowierten oder auffälligen Mitarbeitenden angeblich schwertun würde. Ich denke aber vielmehr an vorherrschende Ängste in den Köpfen der Entscheidungstragenden – meist vermutlich infolge ausbleibender Kontaktgelegenheiten mit Minderheiten in unserer normierten Gesellschaft.
Wie viel bringen geschlechtsneutrale Inserate und das LGBTI-Label?
Die Anzahl geschlechtsneutraler Stelleninserate ist gemäss Sonntagszeitung vom 7. April 2019 seit rund einem Jahr steigend. Bei einigen Firmen werden die herkömmlichen «m/w»-Geschlechter-Bezeichnungen der gewünschten Person um das «d» für «divers» erweitert. Die Frage, ob sich nun für den gesuchten «Vorarbeiter Gleisbau (m/w/d)» tatsächlich auch Kandidaten des dritten Geschlechts bewerben und sogar angestellt werden oder es nur bei der politisch korrekten Wortklauberei bleibt, ist noch unbeantwortet.
In dieselbe Richtung geht die hehre Absicht des Swiss LGBTI-Labels, das einige Non-Profit-Organisationen im Frühling dieses Jahres gegründet haben. Es setzt sich zum Ziel, vermehrt die Community lesbischer, gay, bi-, trans- und intersexueller Kandidierende in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das Interesse auf Unternehmensseite am Label ist offenbar steigend. Gelingt es aber auch im Sinne des Employer Branding, die Zielgruppe weiterer Geschlechtsidentitäten auf dem Bewerbermarkt zu gewinnen?
Kultur leben statt proklamieren
Ich gehe mit der Swiss Re einig, dass wir eine aufgeschlossene Führungskultur brauchen, die dem bunten Querschnitt unserer Gesellschaft gerecht wird. Aber sie muss mehr beinhalten als publikumswirksame Augenwischerei, trendige Lippenbekenntnisse und verbale Spitzfindigkeiten.
Eine aufgeschlossene Kultur beginnt in den Köpfen des Managements – darf aber nicht nur dortbleiben. Es gilt, sie im Alltag engagiert anzuwenden. Im ganzen Unternehmen soll Diversity in der Zusammensetzung der Mitarbeitenden gelebt und nicht proklamiert werden. Dafür braucht es eine Vorbildfunktion auf Führungsebene. Diese entsteht zum Beispiel, indem offene Stellen ganz bewusst mit Menschen besetzt werden, die bislang in der Selektion ausgegrenzt blieben. Also mit einer gezielten Auswahl aus der gesamten Palette an – wie eingangs erwähnt – übergewichtigen, behinderten, ausgesteuerten, dunkelhäutigen, transsexuellen und über 55-jährigen Kandidatinnen und Kandidaten.
Dies hätte eine unerhörte Signalfunktion, die wirksamer ist als jede noch so löbliche und wohlklingende Kampagne. Eine divers aufgestellte Belegschaft wäre nicht nur ein Aushängeschild für eine fortschrittliche Arbeitgebermarke, sondern könnte sich auch kundenseitig positiv auswirken. Wer weiss: Vielleicht würde eine solche personelle Durchmischung auch dem einen oder anderen Firmenprodukt oder der einen oder anderen Dienstleistung gut anstehen? Denn auch diese zielen auf eine breit zusammengesetzte Kundschaft aller Altersgruppen, Hautfarben, sexueller Präferenzen sowie physisch und psychischer Befindlichkeiten ab.
Letztendlich ist «Diversity und Inclusion» in erster Linie eine Frage der inneren Überzeugung und, in einem zweiten Schritt, der Zivilcourage bei der Umsetzung – begleitet von verbindlichen Richtlinien, gezielten Weiterbildungen und mutigen Diskussionen.